Siliconned - Emmanuel Maggiori
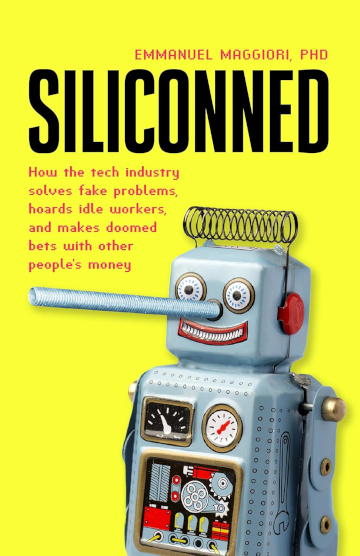
- Autor
- Emmanuel Maggiori, PhD
- Titel
- Siliconned
- Ausgabe
- Applied Maths Ltd. 2024, 230 Seiten (eBook)
- Sprache
- Englisch
“Wie die Tech-Industrie vorgetäuschte Probleme löst, untätige Arbeiter anhäuft und zum Scheitern verurteilte Wetten mit dem Geld anderer Leute abschließt”, so der Untertitel dieses Buchs (der, wie alle folgenden Zitate, von mir frei aus dem Englischen übersetzt wurde). Sein Autor, Emmanuel Maggiori, PhD , weiß, wovon er spricht: Maggiori kann nicht nur einen Doktortitel in Informatik, sowie wissenschaftliche Forschungsarbeit in den Bereichen Deep Learning, Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz vorweisen, sondern auch langjährige Berufserfahrung in der IT-Branche, sowohl in Start-Ups als auch in großen Unternehmen wie Expedia und Vodafone.
Dass diese Berufserfahrung einiges an Frustration und Enttäuschungen mit sich brachte, hatte Maggiori bereits eindrucksvoll in einem viral gegangenen Artikel beschrieben. Der Artikel thematisiert weitverbreitete Untätigkeit und Unproduktivität als Konstanten im Arbeitsalltag vieler Softwareentwickler, während in der IT-Branche blind Hypes gefolgt und unsinnige Rituale gepflegt werden und Geld kein Problem, sondern im Überfluss verfügbar zu sein scheint.
Diese Beobachtungen vertieft der Autor im vorliegenden Buch zu genaueren Analysen, ausgehend von der Frage, wie sich solche Missstände überhaupt entwickeln und etablieren konnten und warum es in der Tech-Industrie regelmäßig, beinahe periodisch und zyklisch zu befremdlichen Exzessen an Geldverschwendung und Größenwahn kommt, denen stets ein unvermeidlicher Absturz folgt, auf dass das Spiel wieder von vorne beginne. Neben den ebenso plötzlichen wie drastischen Einsparungen und Massenentlassungen der letzten Jahre in der Software-Branche, nach Jahren der großen Sause mit scheinbar unbeschränktem Geldfluss und Bedarf an Programmierern, wird die berühmt-berüchtigte “Dotcom-Blase” der späten 1990er Jahre als Vorläufer genannt und auch dem gerade zu neuen Höhenflügen ansetzenden KI-Hype kein glückliches Ende vorausgesagt.
Problemfelder
Tatsächlich greift der Untertitel zu kurz, nicht nur die Tech-Industrie wird kritisiert, ein bedeutender Teil des Buchs beschäftigt sich auch mit den Bereichen der Finanzwelt und (Finanz-)Politik allgemein. Im Verlauf der Lektüre wird deutlich, dass Maggiori auch in der Unternehmens- und Finanzkreisen gut vernetzt ist. Dies ermöglicht ihm, nicht nur aus der Perspektive eines erfahrenen Softwareentwicklers zu kritisieren, was in “der Industrie” falsch läuft, sondern auch Missstände in der Gründerszene, bei Start-Ups und Großkonzernen, sowie im Bereich Venture Capital (Wagniskapital/Risikokapital) und der Wirtschafts- und Finanzpolitik genauer unter die Lupe zu nehmen.
Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert, von denen sich die ersten beiden den ausgesprochen fragwürdigen Projektideen, Planungsprozessen (oder deren Mangel) und grundlegendem Verhalten einer Vielzahl von Start-Ups im Software-Bereich widmen.
1.) Start-Ups mit kurzsichtiger Planung, verfehlten Strategien und weltfremden Produkten
“Es ist eigentlich offensichtlich, dass man nur an Problemen arbeiten sollte, die auch existieren. Trotzdem ist der mit Abstand häufigste Fehler von Start-Ups, dass sie Probleme lösen, die gar niemand hat.” ~ Paul Graham, S. 25
Maggiori kritisiert anhand ebenso eindrucksvoller wie absurd-komischer Beispiele, dass viele Start-Ups sowohl die gegebenen Marktrealitäten als auch die Bedürfnisse und Probleme ihrer Zielkundschaft völlig ignorieren. Stattdessen versuchen sie mit Produkten auf den Markt zu drängen, die niemand will oder braucht, die nicht funktionieren können und deren Erfolg einem Wunder gleichkommen würde.
Der bestimmende Gedanke hinter dem “Wunderglauben” ist die Hoffnung auf den “ganz großen Wurf”, etwas nie Dagewesenes, das die bestehende Branche revolutioniert, zu Marktdominanz und sagenhaften Gewinnen führt, dem Beispiel von z.B. Amazon, Google oder Facebook folgend. Darunter scheint es nicht mehr zu gehen, kleiner Brötchen werden nicht gebacken.
Unterschieden wird dabei scherzhaft der Glaube an Marktwunder (ein bestehender Markt sowie das Verhalten der Konkurrenz und der Verbraucher müsste sich über Nacht komplett umkehren), technische Wunder (statt an technischen Durchbrüchen zu forschen, wird so getan, als seien diese schon da oder würden sich irgendwie von selbst einstellen) und Menschenwunder (wenn Person X das Unternehmen gründet/leitet, muss sich der Erfolg allein aufgrund der charismatischen Persönlichkeit/der Berufserfahrung automatisch einstellen).
Als große Gefahr sieht Maggiori auch, dass die meisten Start-Ups sich keinerlei Gedanken über einen Burggraben (“moat”) machen. Unter diesem von Warren Buffett eingeführten Begriff versteht man eine Art von Schutzeffekt in Form eines Wettbewerbsvorteils, der ein Unternehmen vor Nachahmern und Konkurrenten schützt, die sich unweigerlich in hoher Zahl einstellen werden, sobald ein Produkt oder eine Dienstleistung erste Erfolge auf dem Markt zeigt.
Anstatt an echten Burggräben wie dem Netzwerkeffekt oder hohen Wechselkosten zu arbeiten, wird sich entweder keinerlei Gedanken über dieses Konzept gemacht, oder aber eine Illusion von vermeintlichen Burggräben gepflegt. Wie der 10x Illusion (das Produkt sei zehnmal besser als das der Konkurrenz), der Größenordnungs Illusion (die Größe bzw. finanzielle Stärke des Unternehmens schützt vor Konkurrenz) oder der Marken Illusion (der etablierte Name schützt vor Konkurrenz). Der Autor zeigt anhand von Beispielen, dass diese vermeintlichen Burggräben eben keine sind und dass selbst die momentanen Platzhirsche am Markt sich dessen auch voll und ganz bewusst sind.
Auch dass die meisten Start-Ups ihre Strategie einzig und allein auf einem exzessiven Fokus auf Wachstum gründen, Wachstum um jeden Preis, so schnell und explosiv wie möglich, wird als großer Fehler kritisiert. Maggiori sieht es als Irrweg an, dass die meisten frischgebackenen Start-Ups sich sofort an das Einwerben von Millionensummen bei Investoren machen. Dies wird beinahe als eine Art Initiationsritus und “Must-Have” praktiziert, während die Gründer sich keinerlei Gedanken machen und keine Konzepte vorlegen können, wie ihre Unternehmen jemals selbst profitabel werden könnten, sondern wiederum auf ein Wunder hoffen. Maggiori zeigt, dass diese Praxis bei Start-Ups und gerade im Silicon Valley gang und gäbe ist und sogar etablierte Branchengrößen wie Spotify, Uber, Fiver und mehr nur mit jährlichen Finanzspritzen durch Investoren überleben können, während sie selbst Jahr für Jahr nur Verluste und rote Zahlen schreiben.
2.) Venture Kapital und Finanzpolitik schaffen finanzielle Fehlanreize
“Macht eigentlich niemand mehr Due Diligence Prüfungen?” ~ Financial Times, S. 95
Das zentrale dritte Kapitel widmet sich der Frage, warum viele Start-Ups trotz offenkundig absurder Geschäftsideen, dem Ignorieren von Marktrealitäten und Kundenbedürfnissen und allgemeiner Planlosigkeit trotzdem mit Millionenbeträgen von Investoren unterstützt und geradezu euphorisch angepriesen werden. Die wichtigste Rolle als größte Geldgeber spielen hier Venture Kapitalgesellschaften (VC, auf Deutsch auch: Wagniskapital/Risikokapital), die Fehlanreize für Start-Ups schaffen und fördern, weil sie ihrerseits selbst von Fehlanreizen profitieren.
Maggiori führt aus, wie die VC Gesellschaften ihren Hauptgewinn nicht etwas durch erfolgreiche Investitionen erzielen, sondern stattdessen Millionenprofite durch die fixen Verwaltungsgebühren auf ihre Fonds erzielen. Diese Fonds setzen sich aus dem Kapital von Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, die ihr Kapital in den Fond der VC Gesellschaft investieren, damit diese es gewinnbringend weiterinvestiert. Je höher die Summe eines Fonds ist, desto mehr Verwaltungsgebühren können die VC Gesellschaften fordern. Dabei sind diese Gebühren unabhängig vom Erfolg der Investitionen der VC Gesellschaft sind und auch im Falle eines Totalverlusts erhoben werden.
Somit ist leicht erkennbar, wie für VC Gesellschaften eine umsichtige, realistisch gewinnversprechende Investitionsstrategie zweitrangig werden konnte. Stattdessen liegt der Fokus erkennbar auf dem Aufbau immer mehr und immer größerer Fonds. Diese Tatsache, sowie dass die Investoren, die in einen VC Fond einzahlen, einer vertraglichen Schweigepflicht zu den erzielten Ergebnissen unterliegen und die Gesellschaften selbst nur äußerst selten und ungern konkrete Zahlen veröffentlichen, dafür aber unbelegt sagenhafte Gewinnmargen anpreisen, sollte sämtliche Alarmglocken läuten lassen.
Allerdings führt Maggiori überzeugend aus, wie effizient VC Gesellschaften, die er als “Meister des Storytelling” bezeichnet, mit künstlich erzeugtem Hype und der “fear of missing out” ("FOMO") arbeiten, also der Angst ihrer Investoren, etwas ganz Großes und sagenhafte Gewinne zu verpassen. Mitreißendes Storytelling, charismatische Gründer und zügellose Hypes werden von den VC Gesellschaften als probate Mittel gesehen, immer höhere Investitionen in ihre Fonds einzuwerben. Und keine Branche verfügt über derart mitreißende Zukunftsvisionen und verspricht derart überwältigende Gewinne bei vergleichsweise geringen Herstellungs- und Betriebskosten, wie die IT-Branche.
An dieser Stelle drängt sich auch eine Erklärung auf, wieso charismatische Blender wie Adam Neumann und andere, oder gar kriminelle Betrüger wie Sam Bankman-Fried, bei VC Gesellschaften nicht nur bereitwillig finanziert, sondern regelrecht gefeiert und hochgeschrieben wurden und warum sie so hoch im Kurs standen und teils noch immer stehen. So werden eben auch bereits einmal mit verheerendem Bankrott gescheiterte Unternehmensgründer, wie Adam Neuman mit WeWork, erneut bereitwillig mit Millioneninvestitionen für ihr nächstes unausgegorenes Projekt unterstützt, wenn sie es nur vor Publikum gut verkaufen und Hype bzw. FOMO erzeugen können. Maggiori erwähnt hier die zynische Strategie des “Greater Fool”, die gemeinsame Suche von Start-Up Gründern und VC Gesellschaften nach einem “größeren Narren”, den man täuschen und dem man die eigenen, komplett überbewerteten Geschäftskonzepte und -anteile teuer verkaufen oder eine hohe Investition schmackhaft machen kann.
Das folgende Kapitel zeigt dann auf, wieso scheinbar unbegrenzte Mengen an Geld im Umlauf sind und eine so große Bereitschaft besteht, in hochriskante VC Fonds zu investieren: die als Gegenmittel zu Wirtschaftskrisen wie dem Platzen der “Dotcom Blase” oder der Finanz- und Immobilienkrise 2008 politisch geförderte Niedrigzinspolitik der Zentralbanken (ZIRP = “zero interest rate policy”) führte zum einen zu leichten Verfügbarkeit von Krediten. Verschärfend hat die begleitende Maßnahme der quantitativen Lockerung (QE = “quantitative easing”), dem massenhaften Ankauf von Staatsanleihen und Wertpapieren durch die Zentralbanken, um mehr Geld und Liquidität auf den Markt zu bringen, dazu geführt, Zinsen auf Sparkonten und bislang relativ sichere (wenn auch überschaubare) Gewinne durch wenig riskante Anleihen und Wertpapiere unrentabel zu machen und so Investitionen in riskantere, aber größere Gewinne versprechende Alternativen zu motivieren.
Leser mit Interesse an Wirtschaftstheorie wird es freuen, dass Maggiori an dieser Stelle mainstream-kritische Theorien wie die der der Österreichischen Schule oder den Neokeynesianismus vorstellt und mit den vorherrschenden, akademisch und politisch dominanten Wirtschaftstheorien vergleicht, die dabei gänzlich anders geartete Sichtweisen auf Ursachen und Lösungen der wirtschaftliche Krisen der letzten Jahrzehnte bieten.
Abschließend wird die ausgesprochen sorglose staatliche Vergabe von Steuergeldern in Form von Subventionen ohne Pflicht auf Rückzahlung an Start-Ups aus dem Bereich der IT kritisiert. Dabei kann Maggiori aus eigener Berufserfahrung berichten, dass die EU ausgesprochen großzügig, schnell und unbürokratisch Steuergelder in von Anfang an und für jeden erkennbar zum Scheitern verurteilte Unternehmen investiert, solange nur die richtigen Schlagworte wie “Umweltschutz” genannt werden, egal ob es Sinn ergibt oder nicht.
3.) Mit Agilen Methoden unmotiviert und unproduktiv durch den Arbeitsalltag
“Arbeit dehnt sich aus, so dass sie die Zeit, die für ihre Fertigstellung zur Verfügung steht, auch ganz ausfüllt.” ~ Cyril Northcote Parkinson, S. 144
Das vorletzte Kapitel ist am stärksten vom eingangs erwähnten viralen Artikel des Autors inspiriert und dürfte auch dasjenige sein, das den höchsten persönlichen Wiedererkennungswert für jeden hat, der schon einmal in der Softwareentwicklung gearbeitet hat. Maggiori kritisiert zum einen planlose Unternehmensführung, die dank dem lange Zeit herrschenden Geldüberfluss Programmierer “auf Vorrat” einstellt, ohne dass überhaupt genügend Arbeit existiert, oder auch nur ein Plan, woran konkret eigentlich gearbeitet werden soll.
Und während sich bezahltes Nichtstun zunächst wie ein Traumjob anhört, gibt Maggiori zu bedenken, dass sich auf diese Weise zum einen (berechtigte) Ressentiments unter der restlichen, wirklich arbeitenden Bevölkerung bilden, zum anderen langfristig gesehen Motivation und zukünftige Karrierechancen der “Entwickler im Wartestand” schweren Schaden nehmen. Selbes gilt für die Arbeit an offensichtlich aussichtslosen, zum Scheitern verurteilten Projekte, die weder Motivation und Selbstwert der Entwickler heben, noch zu vorzeigbaren Resultaten für zukünftige Stellenbewerbungen führen.
Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die den Arbeitsalltag in der Softwareentwicklung dominierenden sogenannten Agilen Methoden. Während Maggiori die Prinzipien der Agilen Entwicklung - zeitnah eine erste funktionsfähige Version, ein “Minimum Viable Product” (MVP) zu veröffentlichen und es dann kontinuierlich weiterentwickeln, mit häufigen Updates und neuen Features und in enger Rücksprache mit dem Kunden - für sehr sinnvoll und nützlich hält, kritisiert er die dogmatisch-starren Regeln für den Arbeitsalltag wie sie z.B. das agile Framework Scrum aufstellt.
Diese Regeln sind alles andere als agil und flexibel, führen zu einer großen Menge an “Meta-Arbeit” wie stundenlangen Meetings, Besprechungen, täglichen Briefings zu für die Mehrzahl der Teilnehmer völlig unbedeutenden Themen und ausufernden Diskussionen über jeden kleine Schritt, die von der echten Arbeit abhalten.
Maggiori zeigt auch, wie agile Regeln wie diejenige, dass neue Features in zweiwöchigem Rhythmus (“Sprints”) fertiggestellt werden müssen, zu Task Bloat führen: Entwickler schätzen die anstehenden Aufgaben als wesentlich schwieriger und zeitaufwendiger ein, als sie tatsächlich sind, damit sie einen ausreichenden Zeitpuffer haben, um auf jeden Fall fertig zu werden. Das geschieht aus Selbstschutz heraus, um sich auf keinen Fall zu viel aufzubürden und am Ende des Sprints kein Ergebnis vorweisen zu können.
Auf diese Weise werden Aufgaben, die in von einer Person in ein, zwei Arbeitstagen (oder gar wenigen Stunden) erledigt werden könnten, zu momumentalen Herausforderungen aufgeblasen, die mehrere Wochen und Entwickler “in Anspruch nehmen”. Dies ist laut Maggiori ein inhärentes Problem des agilen Regelwerks, das sich nach und nach zuverlässig auch in anfangs motivierte Entwickler-Teams einschleicht, zumal der Arbeitsaufwand eines Software-Features von Fachfremden nur schwer realistisch eingeschätzt werden kann.
Lösungsvorschläge
Im letzten Kapitel bietet Maggiori Lösungsvorschläge für die genannten Probleme. Für Start-Ups wird folgerichtig empfohlen, unter Einbezug der Marktrealitäten den Fokus auf echte Kundenbedürfnisse und bestehende Probleme richten, um Projekte, die nur auf “Wunderglauben” basieren, zu vermeiden und langfristig profitable und mit Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz ausgestattete Unternehmen aufzubauen.
Etwas hilflos wirken dagegen die Lösungsvorschläge für die Missstände bei Venture-Kapitalgesellschaften und Zentralbankenpolitik/Wirtschaftstheorie und -politik. Maggiori selbst gibt zu bedenken, dass aus Sicht der VC Gesellschaften gar kein Änderungsbedarf besteht, weil sie Gesellschaften mit der bestehenden Methode großen Erfolg haben und für sich selbst hohe Gewinne erzielen.
Auch ein Umdenken in der Finanz- und Wirtschaftspolitik unter Einbezug alternativer Lehrmeinungen, Erklärungsversuche und Lösungsvorschläge für Krisen erscheint aufgrund der völlig vergifteten, von persönlichen Animositäten und erbitterten Vorwürfen durchzugenen Diskussionskultur zwischen Mainstream-Lager und alternativen Lagern wie der Österreichischen Schule oder den Neokeynesianern kaum realistisch, wie Maggiori eingesteht.
Was den oftmal frustrierenden und unproduktiven Arbeitsalltag von Softwareentwicklern angeht, plädiert Maggiori für ein Beherzigen der agilen Prinzipien bei gleichzeitiger Flexibilität der Umsetzung im Arbeitsalltag: an die Stelle starrer Formen und festgelegter Rituale sollen Absprachen je nach Bedarf und ein Fokus auf die Umsetzung wichtiger Features statt dem Abarbeiten eines Backlogs in festgegebenen Zeitspannen treten.
Abschließende Bewertung
Ich kann das Buch nicht nur jedem, der einen Hintergrund in der Softwareentwicklung oder anderweitig Erfahrung in der IT-Branche hat, empfehlen, sondern lege es auch allen ans Herz, die sich allgemein für Start-Ups, Wirtschaftstheorie und die Finanzwelt interessieren. Ebenso allen, die offen für kritische Stimmen in einer notorisch optimistischen und dauer-gehypten Branche sind, die wie kaum eine andere als Garant einer glorreichen Zukunft und von segensbringendem Fortschritt besungen wird.
Maggiori gelingt es, eine eindrucksvolle Schilderung der Instabilität und der problematischen Tendenzen in und um die Tech Branche zu präsentieren. Er weiß wovon er spricht, hat die unterschiedlichen Themenfelder offensichtlich gründlich recherchiert und argumentiert faktenbasiert und mit konkreten Zahlen und Beispielen.
Dabei ist sein Schreibstil aber nie trocken, langweilig oder belehrend, sondernd lebendig und unterhaltsam zu lesen. Persönliche Anekdoten und bizarre Episoden aus der Welt der Start-Ups sorgen für Kopfschütteln und Lacher gleichermaßen. Mein persönliches Highlight der Absurdität ist dabei die Geschichte des Start-Up Juicero, das die “wagemutige” Geschäftsidee einer “High-Tech”, Wi-Fi gesteuerten Saftpresse für schlanke $699 pro Gerät verfolgte, wobei zusätzlich jede Kapsel mit Fruchtsaft noch einmal $5-7 kosten würde - und dafür von Investoren mit $120 Millionen unterstützt wurde.
Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen Start-Up Szene, der Finanzwelt und der Finanz- und Wirtschaftspolitik ist aus meiner Sicht eine große Stärke des Buchs. Auf diese Art entsteht ein Bild vom “großen Ganzen” und es wird klar wird, dass die Misere, die der Autor beschreibt, viele Väter - und Profiteure - hat und erst aus einem Zusammenspiel verschiedener Fehlentwicklungen und Fehlanreize in verschiedenen Bereichen möglich geworden ist. Eine Schwäche des Buchs würde ich lediglich in Maggioris Lösungsvorschläge sehen.
Diese sind allesamt gut gemeint und zumindest eine verstärkt rationale und realistische Planung, was die Grundlage, Zielsetzungen und Zielgruppen von neu gegründeten Start-Ups angeht sowie ein Umdenken was den rigide-dogmatischen Arbeitsalltag der agilen Softwareentwicklung angeht, sind vorstellbar. Rein aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, nachdem die fetten Jahren mit scheinbar unbegrenztem Geldfluss erst einmal vorüber zu sein scheinen. Ein Umdenken unter VC Gesellschaften, Zentralbanken und Politik ist, wie der Autor ja selbst eingesteht, weitaus weniger wahrscheinlich. Das kann allerdings dem Autor selbstverständlich nicht angelastet werden und ich für meinen Teil muss, wie wohl die Meisten von uns, gestehen, auch keine besseren und realistisch umsetzbaren Vorschläge beisteuern zu können, wie Politik und Investoren zur Vernunft gebracht werden könnten.
Das gezeichente Bild der Tech-Industrie und ihres Umfelds ist ernüchternd, nicht nur aufgrund der inzwischen historischen Beispiele, sondern auch der erwartbaren “ewigen Wiederkunft des Gleichen” wenn sich nichts ändert. Der aktuelle, maßlose und hysterische Hype um “Künstliche Intelligenz” ist ein deutliches Zeichen dafür, erneut stehen die Zeichen einer von jeder Realität und Vernunft losgelösten und mit fantastischen Unsummen gefütterten Spekulationsblase überdeutlich an der Wand.
Emmanuel Maggiori, seines Zeichens ja Experte für KI, hat zu speziell diesem Phänomen ebenfalls ein Buch geschrieben. Dieses wird Thema meiner nächsten Buchbesprechung sein.